Eine Schriftstellerin, die im Nahen Osten aufgewachsen ist, muss ihren Leserinnen erklären, warum man im Irak auf den Häusern unter den Sternen schläft. Sie muss die Hitze der Nacht schildern und die typische Architektur der flachen Dächer. Sie würde darauf verzichten, wendete sie sich an eine irakische Leserschaft.
Was ist es, das ich schildern muss, um die quälende Hitze meiner Nächte einer Leserschaft verständlich zu machen, die die Orte meiner Kindheit nie besucht hat und nie besuchen wird?
Ich habe oft davon gehört, wie es sich anfühlt, wenn man sich nach langer Trennung wiedersieht und vor Freude aufeinander losrennen kann. Aber meine Wirklichkeit besteht aus lärmenden Einstiegshilfen, deren unendlich langsames Ausfahren jeden, wirklich jeden Straßenbahnreisenden nervt, auch wenn sich jeder, wirklich jeder darum bemüht, nicht genervt auszusehen, um dem Verdacht der Diskriminierung zu entgehen. Am schlimmsten ist die Ungeduld des Fahrzeugführenden. Er ist der Chef, er müsste über den Dingen stehen, er müsste freundlich bleiben können aus Professionalität. Aber ich bin nicht die einzige Rollstuhlfahrerin in der Stadt, also ist er von uns Rollstuhlfahrerinnen genervt, weil er mit uns Zeit verliert. Wer Zeit verliert, der gerät in den Verdacht, seine Arbeit nicht richtig gemacht zu haben. Die Verspätungen, die ich täglich überall auslöse, setzen die Menschen, die mir helfen, unter Druck. Sie müssen sich am Ende des Tages genauso rechtfertigen wie ich. Sie dürfen nicht wütend sein auf mich, denn ich bin eine Behinderte, auf die man nicht wütend sein darf. Keiner darf sagen: „Diese Scheiß Behinderten stehlen mir mit ihrer scheiß Behinderung die Zeit eines Gesunden!“ Also streiten sie sich abends lieber mit ihrer Partnerin.
Ich gab ein erbärmliches Kind ab, das sich an den Spielen der anderen nur beteiligen konnte, wenn sie nichts mit Wegrennen, Verstecken oder anderen mir unmöglichen Bewegungsformen zu tun hatten. Wobei ich das mit dem Verstecken sogar versuchte. Ich saß also in irgendeinem Gebüsch und wartete darauf, entdeckt zu werden. Jedes halbwegs empathische Kind, versuchte das zu vermeiden, um mich nicht zu kränken. Ich wurde nie als Erste und nie als Letzte entdeckt. Meist als Zweite oder Dritte. Auffällig unauffällig bleiben im Umgang mit der Behinderten. Die hat es ja schon so nicht leicht. Politische Korrektheit ist die in angestrengte Sprache und zur Schau gestellte Tat sedierte Angst der Leute vor ihren eigenen Vorurteilen. Diese Vorurteile verschwinden nicht einfach durch politische Korrektheit. Im Gegenteil. Sie werden durch sie verborgen. Versteckspiel der Erwachsenen. Politische Korrektheit schützt diejenigen, die sich mit ihr schmücken.
Ich habe früh gelernt, dem Erbarmen der anderen gegenüber dankbar sein zu müssen. Danke, dass ich da sein darf. Mitten unter euch. Obwohl ich ein lebensunfähiges Geschöpf bin. Gefesselt, beschränkt, angewiesen auf eure Hilfe. Danke, dass ihr mir helft, zu überleben. Was ich eigentlich nicht verdient habe, weil es mir die Natur versagt hat, wird dank eurer zivilisatorischen Hilfe möglich. Danke.
Hauptwort des Lebens: Danke!
Unternehmen wir gemeinsam eine meditative Reise. Schließen Sie ihre Augen und sagen Sie hundertmal hintereinander: „Danke!“. Tun sie das jeden Tag morgens, mittags, nachmittags und abends. Vierhundertmal „Danke“ pro Tag. Tun sie das einen Monat lang und unser Gespräch würde Schritt für Schritt auf die Höhe seiner Beteiligten sinken.
Danke.
Supermarktregale, Arbeitsmarkt, Treppenhäuser, Türme. Landschaften als Hindernisse. Kulturräume, Häuser, Sparkassen – alles wird auf Barrierefreiheit abgesucht. Der Blick der Behinderten. Wildnis bedeutet … nichts. Ich habe keine Vorstellung von diesem Begriff. Dieser Begriff verhöhnt mich. Leben heißt Disziplin, Dankbarkeit und emotionale Selbstkontrolle. Raste nicht aus. Bleib bei deinen gutmütigsten Erkenntnissen. Mach eine Therapie. Noch eine. Beginne das Trinken nicht. Nimm keine überflüssigen Tabletten. Ignoriere den Schmerz. Erwarte nichts. Sei dankbar.
Nein. Doch. Ich bekomme allmählich eine Vorstellung vom Begriff Wildnis. Wildnis heißt das, was nicht existiert. Ich versuche, mir einen Dschungel vorzustellen und wie ich mich durchs Dickicht kämpfe. Das Bild spielt mitten in Leipzig. Ich versuche, mir die Taiga, Tundra, das Eis Kanadas vorzustellen und wie ich darauf gleite. Tanz von Kraft um eine Mitte…
Was für den Panther die Stäbe, sind mir die Speichen der Räder. Unaufhörliches Spiel des Lebens: am Rad drehen. Ich muss dankbar sein für die Räder. Sie bringen mich fast überallhin. Ich bin frei. Ich bin wild. Ich bin ein wildes Tier. Ich fahre auf dem Eis Kanadas Tango.
Ich kann meine Oma nicht besuchen. Meine Oma besucht mich. Sie geht sehr schlecht. Aber sie kommt ab und an und sieht nach mir. Letzte Woche hatte ich ihr gesagt, sie brauche sich gar keine Mühe machen, ich sei in Kanada Tango fahren. Sie mache sich Sorgen, erwiderte sie. Vier Tage später war sie tot. Vielleicht starb sie wegen der Sorgen um mich. Ich bin daran gewöhnt, schuldig zu sein, also bringt es mich nicht um, den Tod meiner Oma verursacht zu haben. Ich könnte Amok fahren und mich schuldig fühlen. Es wäre alles wie immer. Der Grad an Schuld macht irgendwann keinen Unterschied mehr, wenn alles Lebendige zig mal in das Gefühl der Schuld getaucht wurde. Wildnis ist nur ein anderes Wort für Unschuld.
Ab und an reise ich mit dem Zug und fahre mit einer Standseilbahn auf einen Berg. Versuchen sie mal im Zug in einem Rollstuhl auf Toilette zu gehen. Haben sie mal jemanden begleitet, der im Zug im Rollstuhl auf die Toilette… Für beide unangenehm. Immer. Soziale Kontakte heißen Pflegerinnen.
Ich versuche, mir Inklusion als Wildnis vorzustellen. Die Bäume nehmen mich auf, ohne zu fragen, warum ich und wie ich und ob man mir… Ich schlafe in ihren Kronen. Irgendwie ist es weich, ich weiß nicht warum. Ich will mir das nicht mehr überlegen müssen. Ich will, dass die Logik aufhört. Ich will, dass es keine Naturgesetze mehr gibt. Es gibt Vögel, die mir Krumen bringen, von denen ich mich ernähre. Ich habe eine gute, wechselnde Aussicht auf meinem Baum. Der Wald, dem mein Baum zugehört, reist immerzu. Er macht mal hier mal dort Halt. Ich sehe die Welt. Von oben. Krass. Gänsehaut. Wegen einer dummen, kindischen Vorstellung. Soweit davon weg bin ich also.
Ich habe immer den gleichen Traum: ich erwache und plötzlich stehe ich auf und gehe. Ich prüfe im Traum, ob ich träume, vergewissere mich, dass ich wach bin. Anschließend raste ich ziemlich aus und schmeiß alle Räder und das, was sie transportieren, aus dem Fenster. Ich könnte damit jemanden umbringen, aber ich denke im Traum nicht daran. Dann aber fällt mir auf, dass ich gerade einen Rollstuhl aus dem Fenster warf und damit jemanden verletzt haben könnte und stürme zum Fenster. In dem Moment wird mir klar, dass ich träume und ich erwache. Das anschließende Gefühl absoluter, totaler, vollkommener Lähmung werde ich nicht zu beschreiben versuchen. Ich stürze in mich zusammen, zerfalle in Teile, werde so schwer, dass eine Kuhle im Bett entsteht, verziehe das Gesicht zur abscheulichen Grimasse. Manchmal schreie ich. Manchmal weine ich. Danach starre ich an die Decke mit weit aufgerissenen Augen, als könne mich das Aufreißen der Augen in eine Welt katapultieren, in der ich aufstehen und gehen kann. Mit dem Aufreißen der Augen und der Notiz, dass dadurch keine Veränderung meines Zustands erreicht werden kann, endet meine Hoffnung. Die Reise geht zu Ende. Ich bin angekommen. Ich starre an die Decke und bin mir meiner Situation in wieder erlangter Klarheit bewusst. Ich tue noch eine Weile so, als wäre ich irre und starre weiter. Ich spreche mit der Decke und befrage sie nach dem Sinn des Lebens. Ich führe dann manchmal einen fruchtbaren Dialog mit der sympathischen weißen Decke, die nichts von mir fordert, die sich nicht beklagt über den Schweißgeruch, der mir seit meinem Traum anhaftet, eine vollkommen freundliche Decke schaut mich an, inklusiv und ausgebildet in allen Anti-Diskriminierungs-Workshops der Welt. Ihr Weiß strahlt eine Unschuld aus, die mich an das Wesen der Wildnis erinnert.
Das Wesen der Wildnis lauert überall, denke ich dann. Auch in mir. Indem ich unschuldig bin, bin ich wild. Denn es gehört zur Wildnis dazu, dass wir alle ein Teil von ihr sind, aber niemand ist sie allein.
Ich fülle meine Rolle aus. Ich trage zur Diversität bei. Das ist oft nicht schön. Aber es ist. Ich bin. Das genügt mir für den Rest dieser Nacht.
Danke.
Autor:
Benjamin Baumann

Eine Antwort zu „Danksagung“
-
Wow! Also ähm man kann hier ja jetzt tatsächlich seinen Senf dazu abgeben… Danke Thom, fürs auf die Story hier aufmerksam machen…
Ich finde sie nicht derb, ganz im Gegenteil, sie geht ganz arg tief unter die Haut… Und wen ich zugegeben, eigentlich auch gar keinen Ahnung davon habe, wie es sich anfühlen muss, glaub ich, dass es leider so sehr wahr ist… Danke fürs mitnehmen und fürs Gänsehaut machen, manchmal braucht man das um anderen ihre Wildnis zumindest von weitem sehen zu können!
Alle Inhalte sind Urheberrechtlich geschützt, eine Vervielfältigung bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der jeweiligen Urheber.
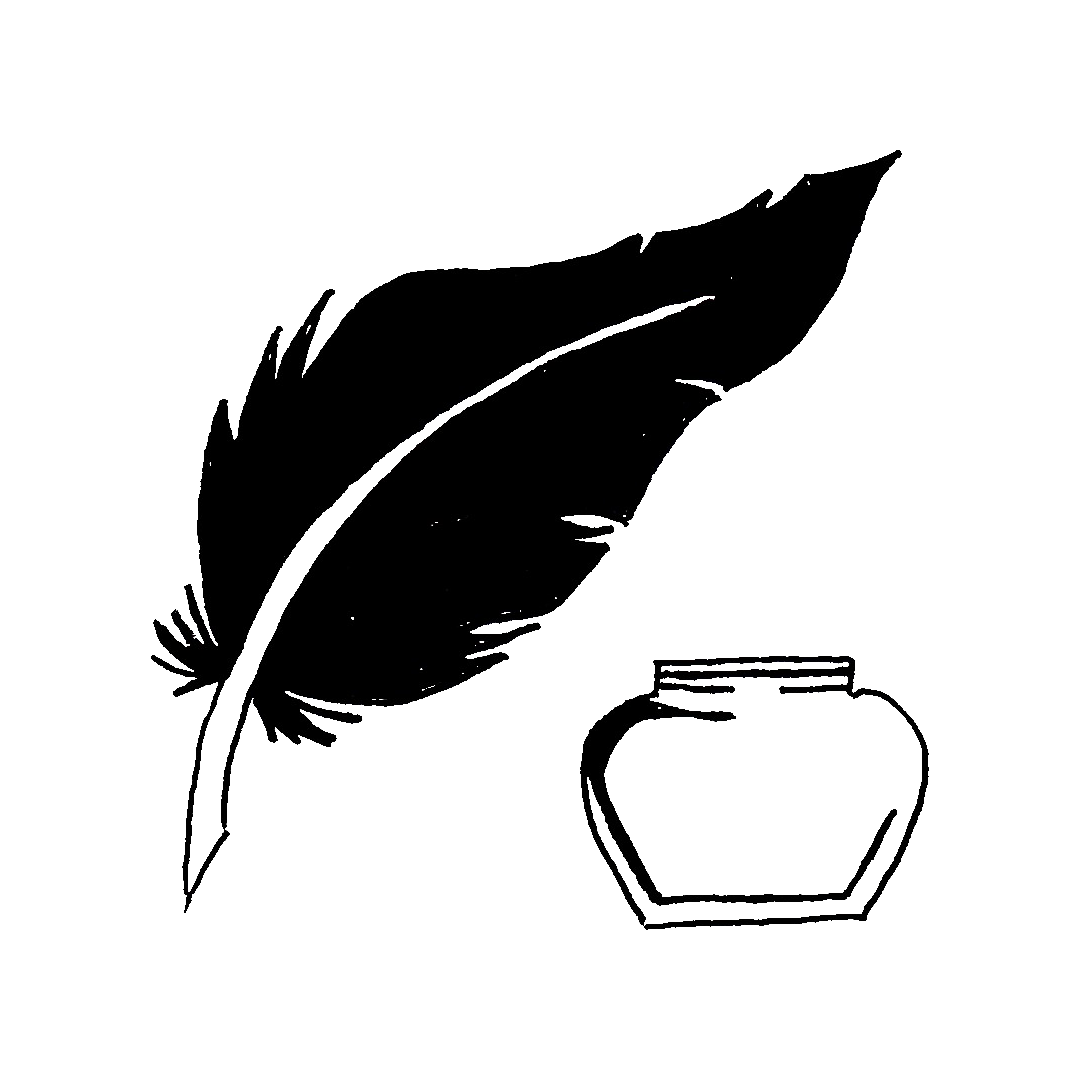
Schreibe einen Kommentar